Veda (Veda), wörtl.: „das Wissen“, die heiligen Schriften Indiens. Manchmal auch Shastra genannt, womit eine vedische oder eine auf dem Veda gründende Schrift gemeint ist.
Den Kern des Veda bilden die Texte, die als Shruti bekannt sind, es ist das von Rishis (Weisen) „gehörte“ Wissen, das als Offenbarungswissen gilt.
Inhaltsverzeichnis
Tabellarische Übersicht
Unterteilt in die vier Vedas. (Alle Teile sind zur Unterscheidung jeweils farblich zugeordnet.)
4 Vedas
Rig-Veda (ṛgveda)
Yajur-Veda (yajurveda)
Sama-Veda (sāmaveda)
Atharva-Veda (atharvaveda)
Diese vier Veden gelten als Kernstück des Veda. Sie bestehen aus:
- Samhitas, Sammlung von Shuktas oder Hymnengruppen,
- Brahmanas, Beschreibung von Opferhandlungen usw.,
- Aranyakas, Unterweisungen für jene, die sich von der Welt zurückgezogen haben, und
- Upanishaden oder der Vedanta, die Vollendung oder das Ziel des Wissens genannt. Ihr Inhalt wurde in den von Vyasa formulierten Brahma-Sutras (oder Uttara-Mimamsa) zusammengefasst.
(Die bedeutendste Sinn-Erklärung der Brahma-Sutras ist das von Vyasa selbst verfasste Bhagavatam, welches als die reife Frucht am Baum des vedischen Wissens bezeichnet wird.)
108 Upanishaden
Rig-Veda
10 Upanishaden
Yajur-Veda
50 Upanishaden
Sama-Veda
16 Upanishaden
Atharva-Veda
32 Upanishaden
Die wörtliche Bedeutung des Begriff Upanishad lautet: upa (nahe bei), ni (nieder) und shad (sitzen), was wie folgt gedeutet wird: Das Sitzen nahe bei den Füßen des Meisters, um die vertrauliche Lehre über das Sein zu empfangen.1
Die nachfolgenden 108 Upanishaden gelten als die ursprünglichen. Sowohl Anzahl als auch Einteilung können jedoch je nach Schule voneinander abweichen. Manche sprechen heute von über 350 mehr oder weniger bekannten Upanishaden.
1 Wissen wurde immer mündlich überliefert. Nahe bei den Füßen des Meisters zu sein, impliziert auch, alles richtig zu verstehen. Nahe zu sein, bezieht sich jedoch auf die innere, nicht auf die körperliche Nähe.
Wie noch deutlich wird, dienen sie entsprechend der Unterschiedlichkeit der Menschen besonderen Zielen, manche sind sehr alt, manche neueren Datums.
Nachfolgende 10–13 Upanishaden sind das Geistesgut aller religiöser Richtungen, die auf dem Veda gründen, und werden daher als Haupt-Upanishaden bezeichnet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie die wesentlichsten Upanishaden wären.
Haupt-Upanishaden
Aitareya
(Kaushitaki)
Katha
Taittiriyaka
Isavasya
Brihadaranyaka
(Svetasvatara)
Kena
Chandogya
(Maitrayana)
Prasna
Mandukya
Mundaka
Samanya-Vedanta-Upanishaden
Atmabodha
Mudgala
Akshi
Ekakshara
Garbha
Pranagnihotra
Sariraka
Sukarahasya
Skanda
Sarvasara
Adhyatma
Niralamba
Paingala
Mantrika
Muktika
Subala
Mahat
Maitrayani
Vajrasuci
Savitri
Atma
Surya
Sannyasa-Upanishaden
Nirvana
Avadhuta
Katharudra
Brahma
Jabala
Turiyatita
Paramahamsa
Bhikshuka
Yajnavalkya
Satyayani
Aruneya
Kundika
Samnyasa
Narada-Parivrajakas
Parabrahma
Paramahamsa-Parivrajakas
Yoga-Upanishaden
Nadabindu
Amrtanada
Amrtabindu
Kshurika
Tejobindu
Dhyanabindu
Brahmavidya
Yogakundalini
Yogatattva
Yogasikha
Varaha
Advayataraka
Trisikhibrahmana
Mandalabrahmana
Hamsa
Jabaladarsana
Yogacudaman
Pasupatha-Brahma
Mahavakya
Sandilya
Vaishnava-Upanishaden
— — — — —
Kalisantarana
Narayana
Tarasara
Avyakta
Vasudevai
Krishna
Garuda
Gopalatapani
Tripadavibhuti-mahnarayana
Dattatreya
Kaivalya
Nrisimhatapani
Ramatapani
Ramarahasya
Hayagriva
Shaiva-Upanishaden
Akshamaya
Kalagnirudra
Dakshinamurti
Pancabrahma
Rudrahrdaya
Jabali
Rudrakshajabala
|
Annapurna Tripuratapani Devi Bhavana Sita |
Shakta-Upanishaden
Tripura
Bahvruka
Saubhagyalakshmi
Sarasvatirahasya
— — — — —
Annapurna
Tripuratapani
Devi
Bhavana
Sita
Der fünfte Veda
Die Chandogya-Upanishad2 – nach moderner Auffassung eine der ältesten Upanishaden –, erwähnt mehrmals die Itihasas und Puranas, welche die Verehrung von Krishna, Rama und Narayana lehren.
Daraus lässt sich zweifelsfrei erkennen, dass viele der angeblich „wissenschaftlichen“ Datierungen, welche die Itihasas und Puranas in eine viel jüngere Zeitepoche als den Chandogya-Upanishad legen, mit Vorsicht zu genießen sind.
Zudem ist es hier der von der Wissenschaft anerkannte Veda, welcher die Itihasas und Puranas ebenfalls zum Veda zählt und diese als fünften Veda bezeichnet, was leider von vielen wissenschaftlichen Quellen entweder nicht gewusst oder gar bestritten wird.
2 Chandogya Upanishad VII.1.2 (english). Der Weise Narada Muni zählt hier folgende Texte zum Veda: „Ich kenne Rig-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda und den Atharva-Veda als den vierten Veda. Die Itihasas und Puranas kenne ich als fünften Veda. Ich bin vertraut mit den Pancaratras (Ekayanam) und den Sutras (Lehrschriften zu bestimmten Wissensgebieten).“ Sanatkumara, der hier im siebten Prapathaka der Chandogya-Upanishad zu Narada spricht, nennt ebenfalls mehrmals die Itihasas und Puranas den fünften Veda.
Das Bhagavatam 1.4.20, auch Bhagavata-Purana genannt, bestätigt diese Aufzählung von Narada.
Direkt von Vyasa formuliert
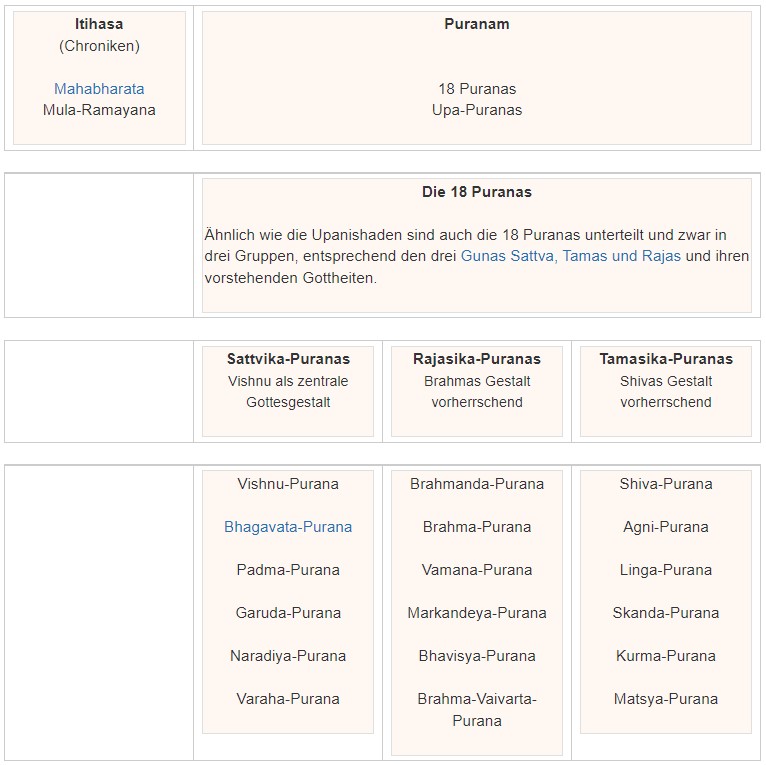
Obigem Bild zugehörige Links:
Das Mahabharata; die drei Gunas Sattva, Rajas und Tamas; das Bhagavata-Purana.
Upa-Veda
Den vier Veden angeschlossen und untergeordnet.
Manche Autoren führen nur vier Upa-Veden an. Die Wahl fällt dabei entweder auf den Arthashastra-Veda oder den Sthapatya-Veda, die beide dem Atharva-Veda zugeordnet sind.
Manche ordnen den Arthashastra-Veda unter den Gesetzbüchern (Smritis) ein.
Der Sthapatya-Veda, aus dem die im Westen als Vastu-Shastra bekannte Architektur hervorgeht, führen andere zu den 27 Teilen vedischer Wissenkünsten auf. Er wird poetisch als ein Erzeugnis der Heirat zwischen Ayur-Veda und Jyotisha-Shastra (Astronomie) beschrieben, da er die Bedürfnisse menschlichen Wohlergehens mit den ihn umgebenden Einflüssen verbindet.
Ayur-Veda
(Medizin, Gesundheit,
Wissenschaft des Lebens)
Dhanur-Veda
(Kampf-, Waffen- und Kriegskunst)
Gandharva-Veda
(die feinen Künste,
Musik, Tanz, Theater)
Artha-Shastra-Veda
(Ökonomie, Staatskunst, Politik)
Sthapatya-Veda
(Architektur, Technik)